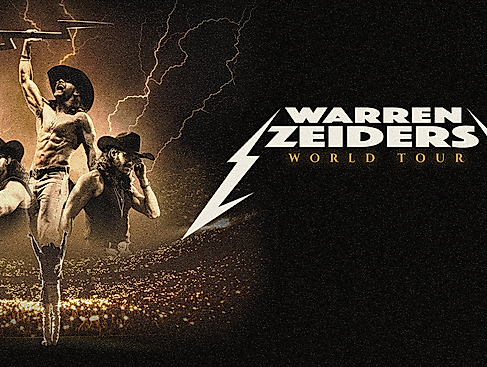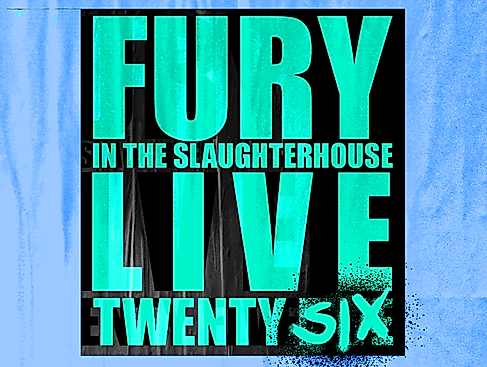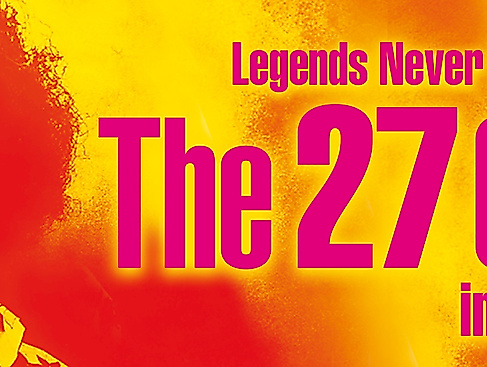Was geschieht, wenn sich Hass, Missgunst und Eifersucht in die Liebe zweier Menschen mischen? Wenn die lichte Seite im Menschen auch eine dunkle in sich trägt? Die Oper beginnt auf der Kehrseite der Liebe, auf der Seite des Bösen und mit der Verwirrung der üblichen Ordnung. Die böse Zauberin Arcabonne gesteht ihre Scham, ein für sie unvertrautes Gefühl zu empfinden: die Liebe für den Ritter Amadis, der ihren Bruder ermordet hat. Nun entspinnt sich ein Psychogramm vierer Figuren in zwei Paaren: dem bösen Geschwisterpaar Arcalaus und Arcabonne auf der einen und der Prinzessin Oriane und Ritter Amadis auf der anderen Seite.
Gefangen zwischen ihrem Tötungstrieb und dem Begehren sät Arcabonne angestachelt durch ihren Bruder Arcalaus zwischen die beiden Liebenden Unfrieden, Zwietracht und Misstrauen und bewirkt die Entzweiung der beiden. Oriane wendet sich im Fortgang von ihrem Geliebten Amadis ab, weil sie ihn enttäuscht der Untreue bezichtigt. Amadis hingegen fühlt sich unverstanden und zurückgewiesen.
Die Handlung ist einfach, ein klassischer Ritterroman, mit Drachen, Zauberern, Rittern und einer befreiten Prinzessin. Aber die wahre Handlung ist bei Johann Christian Bach nicht die sichtbare. Es ist die fortschreitende Veränderung der beiden Personen Amadis und Oriane, deren innere Wandlung zum eigentlichen Sujet der Oper wird. In Prüfungen, wie in der Zauberflöte, wohnt der Zuschauer der Entwicklung eines idealen Mittlerpaares bei.
Warum aber fiel die leichtfüßige Oper – wie ein frischer, früher Mozart klingend – bei ihrer Uraufführung in Paris durch? War die Zeit noch nicht reif für eine solche Musik, war es die Unentschiedenheit zwischen italienischer und französischer Operntradition oder war es der Rückgriff auf ein traditionelles Sujet? Die Oper »Amadis de Gaule« des jüngsten Sohnes von Johann Sebastian Bach, der wie Händel in London Karriere machte und als Komponist und Konzertveranstalter das Publikum in seinen Bann zog, legt den Finger in die Wunde des Pariser Opernpublikums im vorrevolutionären Jahr 1779: Es ist die Kritik an Wollust und Gier, an Hass und Missgunst, an Oberflächlichkeit und Heuchelei, die hier vor Augen geführt wird und für die der Opernbetrieb Sinnbild ist. Es ist eine der ersten aufklärerischen Opern für ein bürgerliches Publikum, die Oper aber war im Jahr 1779 noch ein Forum des Adels. So werden denn auch, als zehn Jahre später die Revolution losbricht, die Opernhäuser symbolhaft durch das revoltierende Volk geschlossen.
Die Liebe hingegen, die die böse Zauberin empfindet, trägt den Tod in sich. Und so stirbt, weil sie Amadis nicht lieben und nicht töten kann, die Zauberin Arcabonne den ersten Liebestod in der Geschichte der Oper. Am Ende aber siegt das Erhabene, die göttliche, reine Liebe der beiden Protagonisten Oriane und Amadis. Sind es aber wirklich zwei Paare gewesen oder doch eher ein einziges Paar in zwei Bildern?
BESETZUNG
CPE.Bach.Chor.Hamburg Chor
B’Rock Orchestra Kammerensemble
Lenneke Ruiten Sopran
Julia Sophie Wagner Sopran
Ilker Arcayürek Tenor
Krešimir Stražanac Bass
Hansjörg Albrecht Leitung
PROGRAMM
Johann Christian Bach
Amadis de Gaule, W. G39